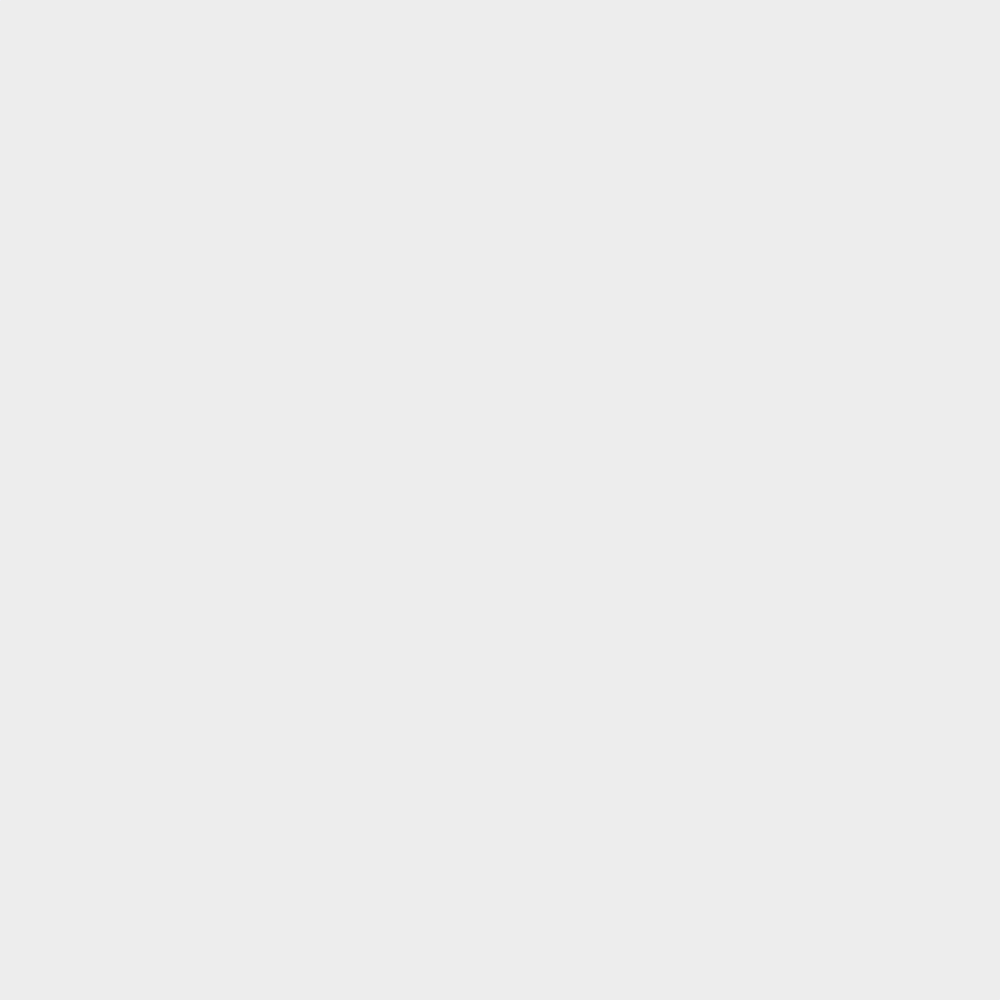Einleitung
Ein nennenswerter Anteil von Frauen lebt nicht ausschließlich heterosexuell. In aktuellen Studien aus Deutschland gaben ca. 2% der Frauen an, lesbisch oder bisexuell zu leben [1, 2], bei 21–25-jährigen Frauen war der Anteilmit 3% lesbisch und 6% bisexuell lebenden Frauen höher [3]. Nicht ausschließlich heterosexuell leben nach einer weiteren Befragung 11–22% der Frauen [4].
Somit sind Frauen, die mit Frauen sexuell aktiv sind oder sich als lesbisch bzw. bisexuell bezeichnen, schon rein zahlenmäßig eine wichtige Gruppe von Patientinnen in der gynäkologischen Versorgung. Als solche wahrgenommen werden sie von viele Ärztinnen und Ärzten trotzdem nicht. Das ist erstaunlich, da doch gerade in der gynäkologischen Versorgung Sexualität, Partnerschaft und Familienplanung zentrale Themen sind.
Erklären lässt sich dieser scheinbare Widerspruch damit, dass – wie Befragungen zeigen – nicht-heterosexuelle Frauen ihre Lebensweise oft nicht von sich aus ansprechen [5, 6]. Außerdem werden sie selten aktiv darauf angesprochen. Die Lebensweise wird so oftmals nicht sichtbar und Ärzte/Ärztinnen gehen weiter davon aus, ausschließlich heterosexuelle Frauen zu behandeln. Das kann die gesundheitliche Versorgung beeinträchtigen und zu Fehlversorgung führen. Und es signalisiert lesbischen und bisexuellen Patientinnen, dass ihre Lebensweise eben nicht selbstverständlich berücksichtigt wird und sie nicht dieselbe Akzeptanz und Anerkennung erfahren wie hetero-sexuelle Frauen.
Es gibt mehrere Gründe für lesbische und bisexuelle Frauen, ihre sexuelle Orientierung zu verschweigen oder nicht aktiv anzusprechen. Oft bekommen sie im Kontakt mit den Behandelnden schlicht keine Gelegenheit. Diese sprechen ihr Gegenüber selbstverständlich als heterosexuell an, die Patientin müsste das Gespräch unterbrechen und dieser Annahme explizit widersprechen. Oft befürchtet sie dabei negative Reaktionen und eine Beeinträchtigung des Kontaktes. Dass diese Sorge nicht unbegründet ist, zeigen zwei Studien aus Deutschland: Ein Fünftel aller befragten lesbischen und bisexuellen Frauen hatte im Kontakt mit Ärzten/Ärztinnen und medizinischem Personal aufgrund der sexuellen Orientierung negative Erfahrungen gemacht. Sie berichteten beispielsweise von ungläubigen Reaktionen, respektloser Behandlung, unangemessenen (voyeuristische) Fragen, distanzierendem Verhalten bis zur Verweigerung medizinischer Hilfe oder gar dem Ratschlag, mit Hilfe einer Psychotherapie heterosexuell zu werden [5, 7].
Zudem gehört es nach wie vor zum Alltag eines Besuchs in einer Praxis, dass Anamnesefragen nur auf eine heterosexuelle Lebensweise ausgerichtet sind oderselbstverständlich davon ausgegangen wird, dass Verhütungsbedarf besteht.
Diese Erfahrungen bzw. Sorgen führen bei einem Teil lesbischer und bisexueller Frauen sogar dazu, im Krankheitsfall den Arztbesuch zu vermeiden. Außerdem nehmen diese Frauen seltener an Früherkennungsuntersuchungen teil [5]. Dieses Phänomen ist als „delay of care“ beschrieben und kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Konsequenzen führen [8]. Insbesondere lesbische und bisexuelle Frauen, die in einem wenig akzeptierenden Umfeld bzw. sehr versteckt leben, sind davon betroffen.
Die Mehrzahl der Ärzte und Ärztinnen jedoch möchte auch nicht heterosexuell lebende Patientinnen fachkompetent und akzeptierend versorgen. Wenn die akzeptierende Haltung der Praxis bzw. Klinik und der Beschäftigten z. B. auf der Webseite deutlich gemacht wird, kann diesen Frauen der Zugang und das offene Ansprechen der sexuellen Orientierung erleichtert werden. Auch Informationsmaterial im Wartezimmer oder der selbstverständliche Einschluss von nicht-heterosexuellen Lebensweisen in die Anamnesebögen und Fragen sind dazu geeignet (Tab. 1).
Minderheitenstress als Gesundheitsrisiko
Stigmatisierung bzw. die Angst davor werden in der Forschung als Minderheitenstress betrachtet, der die körperliche und psychische Gesundheit beeinträchtigt. Zahlreiche Studien aus dem englischen Sprachraum belegen, dass diese Belastung mit einem höheren Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen,Angststörungen, Depressionen und Suchterkrankungen verbunden ist [8–10]. Lesben rauchen mehr als doppelt so häufig wie heterosexuelle Frauen, wohl ebenfalls infolge von Stress. Allerdings hat auch die Tabakindustrie diese spezifische Zielgruppe erkannt und bewirbt sie geschickt, indem sie weibliche Emanzipation und Unabhängigkeit mit dem Bild der rauchenden Frau verknüpft.
Zwar ist die Akzeptanz nicht heterosexueller Lebensweisen in weiten Teilen der Gesellschaft in den letzten Jahren deutlich gewachsen, trotzdem ist die Gleichstellung in allen gesellschaftlichen Bereichen nicht selbstverständlich. Aktuell nehmen Aktivitäten von rechtspopulistischen und christlich-fundamentalen Strömungen, die offen gegen Akzeptanz und Gleichstellung nicht-heterosexueller Menschen eintreten, sogar wieder zu [11].
Neben direkten, offenen Angriffen wie Beschimpfungen, Beleidigungen und lächerlich machen bis hin zu (sexualisierten) körperlichen Angriffen [7,12],erleben Lesben und bisexuelle Frauen häufig subtile Formen der Abwertung. So wird ihre Lebensweise beispielsweise nicht ernst genommen oder Menschen im Umfeld distanzieren sich von ihnen.
Insbesondere das Coming-Out ist eine krisenhafte und vulnerable Lebensphase. Dies gilt ganz besonders für Jugendliche, die in der Pubertät ohnehin verunsichert sind. Diese Jugendlichen erleben oft gerade im nahen Umfeld von Familie oder Gleichaltrigen massive Ablehnung und Ausgrenzung. Das hat für sie schwerwiegende Folgen und ist zum Beispiel mit vermehrt riskantem Konsum von Alkohol und Drogen verbunden sowie mit einem deutlich höheren Suizidrisiko [8,9]. Gerade in dieser Lebensphase sind verständnisvolle Erwachsene zur Unterstützung wichtig. Diese können sich in Jugendeinrichtungen oder der Schule finden, aber auch Ärzte/Ärztinnen können hier maßgeblich sein.
Gleichzeitig zeigen Studien, dass ein erfolgreich bewältigtes Coming-Out zu einer Stärkung und Stabilisierung der Persönlichkeit und Zunahme der Resilienz führt. Psychische Probleme werden offensichtlich bewältigt und es gibt Hinweise, dass Krisen im späteren Leben (zum Beispiel Wechseljahre, Beeinträchtigungen im Alter) besser bewältigt werden [13, 14].So zeigten einige Studien zwar eine höhere Lebenszeitprävalenz von psychischenErkrankungen,die aktuelle Erkrankungsrate lag jedoch im Durchschnitt [9].
Wichtige Ressourcen fürpsychosoziales Wohlbefinden sind an erster Stelle die Partnerschaft, dann das Netz aus Freunden/Freundinnen, das die Funktion einer Wahlfamilie hat. Darauf folgen soziale Netzwerke, beispielsweise in Form von psychosozialen und kulturellen Treffpunkten.
Gynäkologische Krebserkrankungen
Lebensstilfaktoren sowie die reproduktive Biografie haben Einfluss auf die Häufigkeit von Krebserkrankungen. Daher ist anzunehmen, dass mit der sexuellen Orientierung verbundene Faktoren ebenfalls relevant sind. Es gibt allerding nur wenige Daten dazu, ob die sexuelle Orientierung tatsächlich Einfluss auf die Häufigkeit und den Verlauf von Krebs-erkrankungen hat.
Für das Mammakarzinom belegen einige Studien mehr Risikofaktoren bei lesbisch lebenden im Vergleich zu heterosexuellen Frauen – vorwiegend in der reproduktiven Biografie. Ob sich dies auch in höheren Erkrankungs-zahlenausdrückt, ist unklar. Es gibt allerdings einige Hinweise darauf [15].
In Bezug auf das Zervixkarzinom wurde in der Vergangenheit ein geringeres Risiko bei Lesben angenommen. Inzwischen belegen zahlreiche Daten vergleichbare Prävalenzen von HPV-Infektionen [16]. Daher ist auch ein vergleichbares Risiko der Entwicklung von Zervixkarzinomen anzunehmen.
Für Ovarial-und Endometriumkarzinom gibt es keine Daten zum Einfluss der sexuellen Orientierung. Re-produktive Faktoren, wie die seltenere Anwendung hormonaler Kontrazeptiva, könnten ein höheres Risiko bedeuten.
Nicht-heterosexuell lebenden Frauen sollten Früherkennungsuntersuchungen im gleichen Umfang angeboten werden wie heterosexuellen Frauen. Da eine relevante Gruppe lesbisch und bisexuell lebender Frauen gynäkologische Untersuchungen vermeidet, brauchen sie möglicher-weise spezifische Informationen und Ansprache. Diese sollte Akzeptanz für ihre Lebensweise und Verständnis für mögliche Sorgen und Ängste signalisieren.
Wenn Frauen an Krebs erkrankt sind, hat die Unterstützung durch nahe Bezugspersonen (Partnerin, enge Freundinnen) eine große Bedeutung bei der Betreuung. Es sollte explizit und offen auch nach Partnerinnen gefragt werden, um sie entsprechend dem Wunsch der Patientin in die Betreuung einzubeziehen.
Sexuell übertragbare Krankheiten
Zur Häufigkeit von sexuell übertrag-baren Krankheiten (STD) sowie zu Übertragungsrisiken und Schutzmöglichkeiten bei lesbischen und bisexuellen Frauen gibt es deutlich weniger gesichertes Wissen, als für heterosexuell lebende Menschen und schwule Männer. Meist wird zumindest für lesbisch lebende Frauen von einem sehr geringen Risiko ausgegangen. Aktuelle Studien stellen das jedoch zumindest teilweise in Frage – auch wenn sie meist kein repräsentatives Kollektiv untersuchten und/oder kleine Fallzahlen hatten.
Dass eine Übertragung beim Sex zwischen Frauen möglich ist, gilt für alle klassischen STD einschließlich HIV auf der Basis von überprüften und gut dokumentierten Fallberichten als gesichert [17–19]. Die Prävalenz der meisten STD scheint jedoch – zumindest bei Frauen, die ausschließlich mit Frauen sexuell aktiv sind – deutlich geringer zu sein als bei heterosexuell aktiven Frauen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die sexuelle Identität nicht deckungsgleich mit dem sexuellen Verhalten ist.
Dimensionen der sexuellen Orientierung:
- Sexuelle Attraktion (sexuelles Begehren gerichtet auf das gleiche und/oder das Gegen-geschlecht)
- Sexuelle Identität (Selbstbezeichnung als lesbisch, bisexuell, queer, etc.)
- Sexuelles Verhalten (sexuelle Aktivität mit Frauen, Männern oder beiden)
Die Mehrzahl der Frauen mit lesbischer Identität hatte zumindest in der Vergangenheit männliche Sexualpartner. Eine signifikante Minderheit (in verschiedenen Studien zwischen6% und20%) hat auch aktuell Sex mit Männern [18]. Es gibt Hinweise darauf, dass diese Frauen ein höheres Infektionsrisiken eingehen und sich weniger schützen als heterosexuelle Frauen. Demzufolge haben sie auch ein höheres Risiko für die Ansteckung mit einer STD. Für bisexuelle Frauen sind die Daten heterogen. In der Praxis ist es also wichtig, genauer nach Sexualpartnern oder partnerinnen und Infektionsrisiken zu fragen.
Zur Häufigkeit von Chlamydieninfektionen gibt es widersprüchliche Daten. In älteren Studien war die Häufigkeit zumindest bei Frauen, die in den letzten zwölf Monaten nur Sex mit Frauen hatten, mit etwa1% gering. Eine aktuelle Studie fand jedoch auch in dieser Gruppe höhere Prävalenzen von 5–7 %, zumindest für Frauen im Alter von 15–24 Jahren [18, 20].
HIV, Gonorrhoe und Lues scheinen bei Frauen, die im vorangegangenen Jahr nur Sex mit Frauen hatten, selten diagnostiziert zu werden [18]. In Bezug auf HIV-Infektionen spielen für lesbisch lebende Frauen Übertragungswege wie Needle-sharing bei intravenösem Drogengebrauch sowie Sex mit Männern eine deutlich größere Rolle als die Übertragung beim Sex zwischen Frauen.
Bakterielle Vaginosen wurde in einigen Studien bei Frauen mit einer gleichgeschlechtlichen Partnerin häufiger diagnostiziert als bei Frauen mit gegengeschlechtlichen Partnern. Außerdem bestand häufig eine gleichzeitige Infektion bei beiden Partnerinnen. Auch longitudinale Beobachtungen legen eine Übertragung beim Sex zwischen Frauen nahe [18, 21].
Ein großes Problem für die Beratung und Betreuung lesbischer Patientinnen hinsichtlich sexuell übertragbarer Infektionen, ist das mangelnde Wissen zu den Übertragungsrisiken bei einzelnen Sexpraktiken(z.B. bei Oralsex, manueller vaginaler Stimulation oder der gemeinsamen Verwendung von Sexspielzeug) und zum Nutzen von Schutzmöglichkeiten [22]. Das erschwert die Beratung, bei welchen Sexpraktiken und in welchen Situationen die Benutzung von Handschuhen oder Latex-Tüchern sinnvoll erscheint. Und es erschwert Lesben einen angemessenen Umgang mit Infektionsrisiken.
Kinderwunsch
Das häufigste Anliegen, das lesbisch lebende Frauen in eine gynäkologische Praxis führt, ist der Wunsch nach einer Schwangerschaft. Für die Erfüllung ihres Kinderwunsches müssen Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften hohe rechtliche und praktische Hürden überwinden. Sie sind mit vielen Fragen und Entscheidungen konfrontiert, der Weg zu einer Schwangerschaft ist für sie oft kompliziert und vor allem teuer. Daher können viele dieser Frauen ihren Wunsch nicht realisieren. Für die Unterstützung und Betreuung sind psychologische, rechtliche und praktische Informationen hilfreich [23].
Rechtliche Fragestellungen der donogenen Insemination
Die Muster-Richtlinie der Bundesärztekammer zur assistierten Reproduktion enthält seit 2018 keine Beschränkungen mehr in Bezug auf Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Rechtlich bindend sind die Richtlinien der Landesärzte-kammern, die in diesem Punkt un-einheitlich sind. Ohnehin beurteilen jedoch viele Juristen solche Einschränkungen als gesetzeswidrige Benachteiligung aufgrund der sexuellen Orientierung, die dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz widerspricht und damit als rechtlich nicht bindend angesehen werden kann [24, 25].
Eingeschränkt wird die Bereitschaft, Leistungen der assistierten Reproduktion auch Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften anzubieten, durch die Sorge von Samenbanken oder inseminierenden Ärzten/Ärztinnen vor einer Klage auf Unterhaltszahlungen durch Jugend-ämter. Für die donogene Insemination in heterosexuellen Beziehungen ist dies ausgeschlossen, da die An-erkennung der Vaterschaft bereits vor der Geburt möglich ist, so dass das Kind dann zwei unterhaltspflichtige Eltern hat.
Die Möglichkeit solcher Unterhalts-klagen von vielen Juristen als nicht real angesehen!
Stiefkind-Adoption
Die seit 2005 für Frauen in einer eingetragenen Partnerschaft mögliche Stiefkind-Adoption hat zu einer deutlich besseren rechtlichen Absicherung dieser Familien geführt, in-dem nun beide Mütter rechtlich Eltern des Kindes werden können. Dennoch ist das Verfahren für lesbische Mütter unangemessen bürokratisch und langwierig. Konzipiert für Kinder aus einer früheren (heterosexuellen) Beziehung, die in eine neue Partnerschaft eingegliedert werden sollen, berücksichtigt es nicht, dass das Kind in eine bestehende Beziehung der beiden Elternteile hineingeboren wird.
Die Stiefkind-Adoption kann erst nach der Geburt des Kindes beim Vormundschaftsgericht beantragt werden. Die Einwilligung der Mutter kann frühestens acht Wochen nach der Geburt erfolgen. Das Jugendamt prüft dann die Eignung des zukünftigen Stiefelternteils, unter anderem die wirtschaftlichen und gesundheitlichen Verhältnisse. Oft wird eine unterschiedlich bemessene „Adoptionspflegzeit“ festgelegt, um zu prüfen, ob sich zwischen dem Kind und dem Stiefelternteil eine stabile, für das Kind förderliche Beziehung entwickelt. Schließlich wird in einer gerichtlichen Anhörung über den Antrag entschieden. Das Verfahren ist belastend, da mehrfache Behördentermine wahrgenommen und zahlreiche Unterlagen und notariell beglaubigte Erklärungen beschafft werden müssen.
Auch die Einführung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare hat an dieser Situation nichts geändert. Eine rechtliche Gleichstellung soll ein neues Abstammungsgesetz bringen, in dem auch Partnerinnen von schwangeren Frauen bereits während der Schwangerschaft die Elternschaft anerkennen können. Dieses Gesetz wurde jedoch bisher nicht verabschiedet. Stattdessen ist zu befürchten, dass eine Neuregelung die Stiefkind-Adoption weiter erschwert, indem eine Pflichtberatung eingeführt werden soll, die auch den Samenspender einschließt.
Fragen und Entscheidungsprozesse
Eine zentrale Überlegung bei der Entscheidung für einen privaten Samenspender oder Samen von einer Samenbank ist, welche Rolle der Samenspender für die Familie und das Kind spielen soll. Soll das Kind die Möglichkeit haben, ihn irgendwann kennen zu lernen? Soll es unregelmäßigen oder regelmäßigen Kontakt mit ihm haben und ihn als Vater kennen? Oder soll der Samenspender als Vaterfigur in der Familie leben? Die Paare müssen bedenken, dass die Bindung zum Kind für die biologische Mutter möglicherweise enger ist als für die soziale Mutter. Die soziale Mutter kann sich in Konkurrenz zum biologischen Vater sehen. Die Rolle des Samenspenders in der zukünftigen Familie spielt daher nicht nur für das Kind, sondern auch für die Familienkonstellation eine große Rolle.
Neben persönlichen Wünschen spielt bei dieser Entscheidung allerdings eine wesentliche Rolle, welche Möglichkeiten überhaupt verfügbar und zugänglich sind.
Außerdem setzen sich zukünftige lesbische Mütter damit auseinander, wie sich das Aufwachsen mit zwei Müttern auf die Entwicklung der Kinder auswirkt und wie die Kinder mit möglichen Diskriminierungserfahrungen in ihrem sozialen Umfeld umgehen werden. Die Sorge um die psychische Entwicklung von Kindern, die mit gleichgeschlechtlichen Eltern aufwachsen, wurde durch zahlreiche Studien aus den letzten zwanzig Jahren ausgeräumt. Diese belegen, dass es im Vergleich zu heterosexuellen Paaren keine Unterschiede hinsichtlich der Entwicklung der Kinder gibt [25]. Auch zur Situation in Deutschland wurde eine Studie veröffentlicht, die eine unauffällige Entwicklung der Kinder belegt [26].
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen und die Suche nach einem passenden Samenspender dauern meist viele Monate bis Jahre.
Suche nach einem privaten Samenspender
Die meisten Frauen wünschen sich für ihr Kind die Möglichkeit, den biologischen Vater kennenzulernen oder zumindest gelegentlichen Kontakt zu ihm zu haben und würden daher einen privaten Samenspender bevorzugen. Die Suche danach gestaltet sich aber oft schwierig. Es ist nicht leicht, sich mit einer so persönlichen Anfrage an Männer im eigenen Umfeld zu wenden. Dabei ist mit emotionalen und möglicherweise ablehnenden Reaktionen zu rechnen, die ausgehalten und verarbeitet werden müssen, um trotz solcher Fehlschläge neue Anläufe starten zu können.
Wenn die Anfrage auf grundsätzliche Bereitschaft beim potenziellen Samenspender stößt, müssen Wünsche und Vorstellungen in Bezug auf die Elternrolle aller Beteiligten möglichst konkret besprochen und in Einklang gebracht werden. Sichere rechtliche Regelungen sind für keine der Seiten möglich. Die lesbischen Mütter können beispielsweise nicht ausschließen, dass der Vater den Umgang mit dem Kind einklagt. Um-gekehrt kann sich der Samenspender nicht vollständig gegen Unterhaltsansprüche absichern. Rechtliche Beratung, auch über Möglichkeiten und Wirkung von Verträgen, ist dennoch empfehlenswert. Auch in dieser Phase der Gespräche kommt es oft zu Rückzügen auf der einen oder anderen Seite.
Inzwischen gibt es spezifische Medien, um Samenspender zu finden. Dieser Weg birgt andere Schwierigkeiten als die Suche im privaten Umfeld. Zwar ist die Bereitschaft zur Samenspende geklärt, aber es müssen mit völlig fremden Männern sehr persönliche Fragen zu Vaterschaft und Mutterschaft diskutiert und in Bezug auf die Infektionsrisiken auch die sexuellen Gewohnheiten des potenziellen Samenspenders angesprochen werden. Auch mit diesem Weg machen einige Lesben positive Erfahrungen, andere haben unangenehme Begegnungen.
Die Bereitschaft zur Samenspende erfordert praktisches Engagement des Spenders. Er sollte sich auf durch die Samenspende übertragbare Infektionen untersuchen lassen und am besten auch die Samenqualität testen lassen. Er muss, möglicherweise über Monate, kurzfristig zum richtigen Zeitpunkt für die Samenspende verfügbar sein, was entsprechende Flexibilität und räumliche Nähe voraussetzt. Außerdem muss er in dieser Zeit das Risiko sexuell übertragbarer Infektionen nicht nur für sich und seine Sexualpartner und –partnerinnen, sondern auch für die Empfängerin der Samenspende bedenken.
Nutzung von Samenbanken
Viele Lesben brechen die Suche nach einem privaten Samenspender nach einigen Monaten bis Jahren erfolglos ab und wenden sich den Angeboten von Samenbanken zu. Andere scheuen den privaten Weg gänzlich und bevorzugen von Anfang an professionelle Angebote. Diese bieten Sicherheit in Bezug auf Infektionsrisiken und die Qualität des Spermas sowie klare Regelungen zum Kontakt zwischen Kind und Samenspender. Die Spenderdaten werden in einem zentralen Spendersamenregister dokumentiert und 30 Jahre lang aufbewahrt. Ab dem 16. Lebensjahr kann das Kind Informationen zur Identität des Spenders bekommen.
Inzwischen bietet die Mehrzahl der deutschen Samenbanken ihre Leistungen auch Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften an. Die Kosten sind sehr unterschiedlich und schwer kalkulierbar, da sie sich aus verschiedenen Posten zusammensetzen (Grundgebühr für Beratung, Auswahl des Spenders und Reservierung von Proben, Gebühren für die Samenproben, Versandkosten).
Die meisten geben den Samen nur an Kinderwunschpraxen ab. Zwar nimmt die Zahl von Zentren zu, die Inseminationen und auch weitergehende Behandlungen bei Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften anbieten, die Leistungen müssen jedoch komplett privat bezahlt werden. In grenznahen Regionen bietet sich auch der Weg ins Ausland, vor-wiegend nach Dänemark oder in die Niederlande, wo schon seit vielen Jahren offene Angebote bestehen. In der Regel müssen die Frauen für die Inseminationen sowohl in deutschen Kinderwunschzentren als auch im Ausland lange Anreisen auf sich nehmen, die zusätzliche Kosten und erheblichen zeitlichen Aufwand bedeuten. Eine viel genutzte dänische Samenbank verschickt auch Samen nach Deutschland, üblicherweise an Arztpraxen, aber auch direkt an Privatpersonen.
Insemination zu Hause oder in der Praxis
Den optimalen Zeitpunkt für die Insemination können die Frauen mit Hilfe von LH-Teststreifen selbst bestimmen. Am Tag der maximalen LH-Anzeige und dem folgenden Tag kann inseminiert werden, da der Eisprung meist 24–36 Stunden nach dem LH-Anstieg stattfindet. Auch die Schleimbeobachtung ist zur Bestimmung der fruchtbaren Tage geeignet und kann zusammen mit den LH-Tests durchgeführt werden. Die Basaltemperaturmessung ist nicht hilfreich, da sie lediglich rückblickend den Eisprung bestätigt.
Ob darüber hinaus ein Zyklusmonitoring per Ultraschall und Hormonbestimmungen sinnvoll ist, wird unterschiedlich beurteilt. Der finanzielle und organisatorische Aufwand im Zusammenhang mit den Inseminationen kann diese Untersuchungen auch schon bei der ersten Insemination rechtfertigen. Spätestens nach einigen erfolglosen Versuchen sind weitergehende Untersuchungen in jedem Fall hilfreich.
Mit frischem Samen ist das Zeitfenster für die Insemination größer, da die Spermien länger befruchtungs- fähig sind als bei kryokonserviertem Sperma. Daher kann auch schondrei Tage vor dem erwarteten Eisprung inseminiert werden und eventuell zweimal im Abstand von ein bis zwei Tagen. Mit einem privaten Samenspender inseminieren die meisten Frauen zu Hause. Das Sperma kann -in einem Urinbecher mit Deckel transportiert werden. Es muss möglichst körperwarm gehalten werden und ist so einige Stunden beruchtungsfähig. Zur Insemination wird der Samen mit einer normalen Spritze möglichst tief in die Vagina in die Nähe des Muttermunds gespritzt.
Kryokonserviertes Sperma ist maximal 24 Stunden befruchtungsfähig, es muss also möglichst nah am Zeitpunkt des Eisprungs inseminiert werden. Die Schwangerschaftsrate mit kryokonserviertem Samen ist bei einer intrauterinen Insemination (IUI) höher als bei der Insemination vor den Muttermund. Grundsätzlich kann aber auch mit kryokonserviertem Sperma zu Hause intravaginal inseminiert werden, wenn es direkt nach Hause geschickt oder aus einer Arztpraxis mitgenommen wird. Es hat nur ein Volumen von 0,5–1ml, daher ist eine entsprechend englumige Spritze hilfreich. Um das Sperma vollständig aus der Spritze in die Vagina zu befördern, sollte nach der Insemination mit Luft nachgespült werden.
Schwangerschaftsraten
Angaben zur Schwangerschaftsrate sind schwierig, da die vorhandenen Daten sich auf die IUI mit Kryosperma bei heterosexuellen Paaren mit männlicher Infertilität und möglicher Subfertilität der Frau beziehen. Für lesbische Frauen existieren Daten nur in geringen Fallzahlen. Mit frischem Sperma ist die Chance auf eine Schwangerschaft auch bei Insemination in die Vagina größer. Eine Auswertung von 4.415 IUI-Zyklen mit Kryosperma in unstimulierten Zyklen bei heterosexuellen Paaren mit männlicher Infertilität sowie lesbischen Frauen erbrachte die in Tabelle 2 genannten Schwanger-schaftsraten [27].
Ausbleibende Schwangerschaft
Der Weg zu einer Schwangerschaft ist für lesbische Paare in der Regel aufwändiger als für heterosexuelle Paare. Wie körperlich und psychisch belastend eine Kinderwunschbehandlung ist, ist von heterosexuellen Paaren bekannt. Dies sollte bei der Betreuung der Paare bedacht wer-den. Zwischen den Inseminations-zyklen sollte zu Pausen geraten werden, um Gefühle von Enttäuschung und Trauer verarbeiten zu können.
Darüber hinaus ist es sinnvoll, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, dass sich der Kinderwunsch möglicherweise nicht verwirklichen lässt. Ohne diese Reflexion besteht die Gefahr, nach jedem misslungenen Versuch möglichst rasch den nächsten Anlauf zu starten, um der Enttäuschung mit neuer Hoffnung zu begegnen.
Zusammenfassung
Mit 10–20 % stellen nicht heterosexuell lebende Frauen in der gynäkologischen Praxis eine relevante, aber bisher wenig wahrgenommene Gruppe dar. Oft wird die sexuelle Orientierung in der Praxis nicht thematisiert. Diskriminierungserfahrungen in Praxen und Kliniken führen zu einer verminderten Inanspruchnahme auch im Krankheitsfall. Das kann durch akzeptierende Versorgungsstrukturen vermieden werden. Spezifische Fragen bestehen in Bezug auf sexuell übertragbare Infektionen, von denen zumindest einige Gruppen lesbisch oder bisexuell lebender Frauen nicht selten betroffen sind. Da sexuelle Identität und Verhalten nicht immer deckungsgleich sind, erleichtert eine sensible Anamneseerhebung zum aktuellen sexuellen Verhalten die Einschätzung des aktuellen Infektionsrisikos.
Ein häufiges Anliegen von Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist die Verwirklichung ihres Kinderwunsches – sei es mit Hilfe eines Samenspenders aus dem privaten Umfeld oder durch Kryosperma von einer Samenbank. Bei beiden Wegen bestehen spezifische rechtliche, psychosoziale und medizinische Fragen, für die Beratung und medizinische Unterstützung hilfreich sind. Auch im Zusammenhang mit Krebserkrankungen spielt die sexuelle Orientierung eine Rolle. Nicht heterosexuell lebende Frauen können durchspezifische Ansprache zur Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen ermutigt werden. Im Falle einer Krebserkrankung ist die Partnerin oft die wichtigste Unterstützungsperson, die in die Betreuung einbezogen werden sollte.
Schlüsselwörter: Lesbische Frau, Bisexuelle Frau, Kinderwunsch, sexuell übertragbare Infektionen
Korrespondenzadresse:
Helga Seyler
Familienplanungszentrum HH e.V. (FPZ)
Bei der Johanneskirche 20
22767 Hamburg